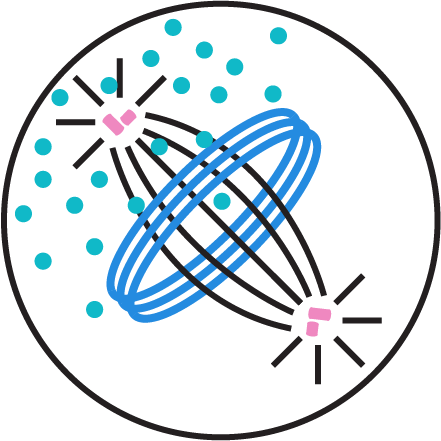Kurz nach die Wende bin ich mit meine Kollegen nach Dresden gekommen mit der folgenden Vision: Können wir Dresden weltweit zu einem der Top-Standorte für Biomedizin entwickeln? Wir wollten eine neue Art von Institut in Deutschland aufbauen – ein Institut, wo Menschen Topforschung betreiben und Spaß dabei haben. Es ist sehr schwer neue Sachen an alten Orten zu machen. In München, London oder Boston ist man immer eingeschränkt durch die ewige Tradition. Um eine neue Struktur aufzubauen, muss man an einen neuen Ort gehen. Dresden schien der ideal Ort dafür zu sein. Angetrieben hat uns auch, zum Aufbau einer der wichtigen Städte in Europa etwas beitragen zu können.
Wir haben einen großartigen Anfang in diese Richtung gemacht, es gibt viele wichtige Einrichtungen hier, dadurch sind rund 2000 Arbeitsplätze geschaffen worden. Der Exzellenz-Status der TU Dresden ist ein weiterer großer Schritt in diese Richtung, zusammen mit den Kollegen in anderen Fakultäten ist es uns gelungen, Dresden in den Top Elf der Universitäten des Landes zu etablieren.
Es ist ganz lehrreich, einmal auf Boston zu blicken. In den 60er Jahren war das eine verschlafene, postindustrielle Universitätsstadt. Dann begann man, ganz konzentriert den Schwerpunkt darauf zu legen, Wissenschaftler in die Stadt zu holen und aus Weltklasse-Universitäten abzuschöpfen – das hat mehr als 90 000 Arbeitsplätze und Milliarden Dollars an Forschungsmitteln gebracht. Ein vergleichbarer Schwerpunkt in den nächsten Jahrzehnten in Dresden kann vergleichbare Ergebnisse liefern. Unsere Universität, die TU Dresden, war schon um 1900 eine der Universitäten mit den bedeutendsten Patenten. Und unsere Stadt ist mindestens ebenso schön und lebenswert wie jede andere große Universitätsstadt der Welt.
Aber, wollen wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben, müssen wir weiter Top-Leute aus aller Welt hierherholen. Nur mit den besten Experten kann das Erreichte weiter wachsen. Und bei dem Versuch, die klügsten Köpfe anzulocken, stehen wir im ständigen Wettbewerb mit anderen Städten – in Deutschland und in der ganzen Welt.
Wie arbeiten wir Wissenschaftler? Man beginnt mit seiner Doktorarbeit, nicht immer, aber meistens im Heimatland. In unserem Institut sind über die Hälfte der Doktoranden aus anderen Ländern. Der Doktortitel ist in der Wissenschaft quasi wie ein Visum: Hat man als junger Wissenschaftler den Doktor in der Tasche, bekommt man ziemlich sicher in jedem erdenklichen Land einen Job. Das ist eine bemerkenswerte Sache, die viele gar nicht bedenken. Danach arbeitet man dann als Postdoc. Man kommt als Experte in ein anderes Land und arbeitet in einem Team aus Wissenschaftlern. Diese Teams formen sich recht schnell und lösen sich auch schnell wieder auf. Wir hatten beispielsweise unlängst eine interessante Entdeckung, die für die Parkinson-Krankheit neue Erkenntnisse brachte. Die Gruppe, die daran arbeitete, bestand aus einem georgischem Gruppenleiter, jemandem aus Spanien, aus der Türkei, und aus Japan. Mittlerweile sind sie alle schon wieder in anderen Ländern. Ich stelle derzeit ein neues Team zusammen, um an den Erkenntnissen weiterzuarbeiten. Top-Wissenschaft hat also eine hohe Fluktuation. In unserem Institute brauchen wir jedes Jahr 100 neue Wissenschaftler.
Wie bringen wir die Leute nach Dresden? Man braucht eine Stadt, in der man gerne lebt, weil sie schöne ist. Ich nenne das ein „two day interview town“. Die besten Wissenschaftler haben Angebote aus aller Welt, und Dresden muss sich da gegen andere Städte wie zum Beispiel San Francisco durchsetzen! Wir bringen interessante Leute also für zwei Tage hierher und müssen sie in dieser kurzen Zeit von Dresden überzeugen.
Ein großer Vorteil Dresdens gegenüber Städten in der BRD war, dass ein großer Teil der Infrastruktur über lange Zeit ungeandert geblieben war; nun konnte man sich die Fehler der Stadtplaner im Westen ansehen und – sie vermeiden. Ein wichtiges Merkmal Dresdens ist seine Kompaktheit. Die Stadt ist nicht, wie Städte im Westen, durch Vorstadt-Wildwuchs zersiedelt worden. Wer glaubt denn wirklich, unsere heißgeliebten Elbwiesen hätten die Straßenbauprogramme im Nachkriegswesten überlebt, die breite Straßen an jedem größeren Fluss entlang vorsahen? Die Schönheit und der Lifestyle der Stadt machen Dresden für ausländische Bewerber immer sofort attraktiv. Wer zu einem Bewerbungsgespräch hierher kommt, verleibt sich sofort in die Stadt.
Was aber noch viel wichtiger ist: Dresden muss weltweit den Ruf haben, dass hier Ausländer gut leben können, sich schnell einleben können und von der Stadtbevölkerung akzeptiert werden. Aber es kommen ja nicht nur Menschen nach Dresden: Wir müssen auch weiterhin Investitionen von außerhalb in die Stadt holen. Wer aber investiert in einen Standort, wenn er sich nicht sicher sein kann, ob er überhaupt die benötigten Fachkräfte bekommt? Und schließlich wollen die Dresdner ihre Produkte ja auch weltweit absetzen. Dazu gehört ein Renommee als tolerante, offene Stadt, damit Geschäftsleute aus Dresden, die ihre Produkte im Ausland anbieten, ein „Made in Dresden“ mit Stolz als Markenzeichen präsentieren können.
Die Offenheit gegenüber Ausländern muss alle Ausländer einbeziehen, nicht nur die hellen Köpfe. Und zwar aus zwei Gründen: Einerseits ist Gastfreundschaft ein Wert an sich. Andererseits: Woher will man denn wissen, wer da vor einem steht? Ein Ausländer, der nach dem Weg fragt, kann sehr wohl eine Million Euro Kapital in der Tasche haben, das er hier investieren will. Ich sage immer: Wenn ich unrasiert morgens zum Bäcker gehe, möchte ich höflich behandelt werden, auch wenn man nicht weiß, dass ich Professor bin.
Können wir hier Wurzeln schlagen?
Hätten Sie mich letztes Jahr gefragt, ich hätte gesagt: Dresden macht Fortschritte, Dresden ist ein toller Ort, an dem man als Ausländer super leben kann. Ich habe mich zwar immer gefragt, warum über das Problem mit Ausländerfeindlichkeit nichts mehr in den Medien erschien – denn eine Zeitlang war dazu ja ständig etwas zu lesen. Wurde das Problem wirklich gelöst?
Und dann kam der PEGIDA-Schock. Als wir dachten, Dresden würde sich in die richtige Richtung bewegen, waren 15.000 Menschen auf der Straße und beschwerten sich über zu viele Ausländer. Ich war im Januar auf einer Dienstreise in Japan, und jeder fragte, was da los sei in Dresden, und ob man als Ausländer in der Stadt leben könne. Als ich zurückkam, war auch meine Arbeitsgruppe völlig aufgelöst. Angst und Sorge hatten sich schnell im ganzen Institut verbreitet.
Fremdenfeindlichkeit wurde wieder zum Problem, in Dresden und auch in ganz Europa. Wir als Ausländer müssen uns fragen, ob es gelingen kann, einen internationalen Forschungsstandort aufzubauen in einer Stadt, in der einige Einwohner offen ihre Ressentiments gegen Ausländer zeigen. Nach Silvester saß ich mit vielen Leuten aus der Wissenschaft und aus der Kultur bei einigen Partys zusammen und wir überlegten: Können wir hier Wurzeln schlagen?
Diese Frage haben wir uns nicht zum ersten Mal gestellt. Schon 1997, als wir das erste Mal darüber nachdachten, nach Dresden zu gehen, sahen wir uns mit zwei Sachen konfrontiert: Das eine waren die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, es flogen Molotow-Cocktails in ein Asylbewerberheim. Dann erklärte der Reiseführer Frommer’s die Neustadt zu einer No-Go-Area – für Ausländer sei es dort zu gefährlich wegen der vielen Neonazis. Können wir in Dresden ein internationales Institut aufbauen? Und ist es vertretbar, internationale Fachkräfte in so eine Stadt zu holen? Das fragten wir uns damals. Wir haben uns damals eingeredet, dass das Einzelfälle sind. Und dann kam die nächste Tragödie, die Ermordung von Marwa, die die Ehefrau eines unserer Doktoranden am Institut war. Unsere schlimmsten Befürchtungen waren wahr geworden. Aber die Reaktion der Stadt und des Freistaates auf diesen Vorfall, die viele Unterstützung aus der Stadt und die vielen Signale, dass Dresden so etwas nicht akzeptiert, ließen uns hoffen, dass es sich um die Tat eines einzelnen Fanatikers handelt. Nun müssen wir uns mit einer noch viel heimtückischeren Bedrohung auseinandersetzen – mit einer großen Masse an Leuten, die gemeinsam marschieren und eine fremdenfeindliche Fahne schwenken.
Seit PEGIDA marschiert, zeigt sich die hässliche Seite und die werden laut, die vorher still waren. Die Menschen, die es OK finden, Ausländer auf der Straße anzupöbeln, nur weil sie anders aussehen. Wir Ausländer sind weniger sicher als die Deutschen, denn wir sind eine Minderheit, und diejenigen, die eindeutig ausländisch aussehen, sind am wenigsten sicher. Das ist für eine moderne Stadt im 21. Jahrhundert wirklich nicht hinnehmbar. Ich hatte heute ein beeindruckendes Gespräch mit Prof. Dr. Ali El-Armouche, Leiter der Toxikologie am Dresdner Universitätsklinikum. Er ist im Libanon geboren, aber mit sechs Jahren ist er nach Bayern gezogen und spricht akzentfreies Deutsch. Er sagte zu mir, als er im August letzten Jahres nach Dresden kam, fühlte er sich wegen der dunklen Hautfarbe fremd und ausgeschlossen. Nicht nur von den Bürgern, aber auch von den Behörden.
Ich habe sehr viel Zeit investiert – wie viele andere Institutsleiter in Dresden auch -, um die Belegschaft, vor allem die ausländischen Mitarbeiter, zu beruhigen. Vor allem ging es mir darum, sie davon zu überzeugen, dass die Gefahr nicht wirklich groß ist. Aber trotzdem: Es wurde bereits viel Schaden angerichtet. Deshalb haben wir viel Energie eingesetzt, um zu zeigen, dass Dresden generell eine offene und tolerante Stadt ist. Vor einem Jahr wurde der Verein „Dresden – Place to be“ gegründet, mit der Grundidee, dass ausländische Forscher und Fachkräfte einen Paten bekommen, der sich um sie kümmert und ihnen im Alltag und beim Start in einer fremden Stadt hilft. Dieser Verein hat auch das große Konzert auf dem Neumarkt mit Herbert Grönemeyer und anderen Künstlern organisiert, und veranstaltet diesen Samstag die Bürgerkonferenz im Congress Center, wo sich die Stadtgesellschaft austauscht darüber, wie man das Zusammenleben mit Ausluandern gut gestalten kann. Diese Veranstaltungen kosten alle sehr viel Geld und werden aus Spenden finanziert – jeder, der noch etwas dazu beitragen will, ist gerne gesehen!
Wie kam es so weit? Warum hat PEGIDA weiter einen solchen Zulauf? Wo doch Zuwanderung die einzige Lösung ist, um den Wohlstand zu halten. Das wichtigste Ziel ist, in Dresden weiter Arbeitsplätze zu schaffen, sodass unsere Kinder, sofern sie das wollen, hier bleiben und wir erleben können, wie auch unsere Enkel weiter daran arbeiten, Dresden zu einer der Top-Städte in der Welt zu entwickeln. Nur wenn Jobs geschaffen werden, wird Dresden weiter wachsen. Ohne sie wird die Stadt schwinden, die jungen Leute werden ihr den Rücken kehren. Und mehr Jobs werden nur entstehen und gedeihen mit dem Engagement und den Investitionen von Ausländern.
“Ausländer schaffen Arbeitsplätze!”
Ein Problem ist, dass zu lange die Politik, gerade im Osten Deutschlands, zu langen nicht dazu stand, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Kein Politiker sagte deutlich: „Ausländer schaffen Arbeitsplätze!“ und erklärte so den Leuten, dass die Zukunft Sachsens ohne Ausländer sehr unsicher aussieht. Es ist schon erstaunlich, dass in einer Umfrage, die mein Kollege Wolfgang Donsbach durchgeführt hat, nur 57% der Dresdner meinen, dass Ausländer und ausländische Investitionen essentiell wichtig für Dresden sind. Das ist schon sehr traurig. Wir Ausländer hätten uns oft mehr Unterstützung von der Politik gewünscht. In Reden und Interviews kamen wir oft nicht vor, höchstens gab es persönliche Gespräche, aber wenig öffentlichen Zuspruch. Ich verstehe nicht, warum ein kleiner Verein wie „Dresden – Place to be“ Großveranstaltungen organisieren muss, die das Image Dresdens zurechtrücken und die Stadt auch als offen und tolerant zeigen – und warum das nicht die Stadt selbst schafft.
Wissenschaft in Dresden steht gerade an der Kippe – entweder entwickelt es sich in eine Richtung wie Boston, oder es fällt zurück auf den Stand einer Provinzstadt mit wenig internationalem Input. Wir müssen allen Bereichen der Gesellschaft klarmachen, dass Ausländer wichtig sind für Dresden. Man könnte da sofort im Bildungsbereich anfangen. In den USA etwa, einem absoluten Einwanderungsland, gehört es ganz selbstverständlich zum Lehrplan dazu, auch Offenheit und Respekt für andere Kulturen zu erlernen. Die Schulbücher zeigen die Vielfalt der Gesellschaft. Deutschland unterscheidet sich gar nicht so sehr von den USA: Hier gibt es 8% Ausländer, in Amerika 13%. Auch die Polizei muss besser sensibilisiert werden. Rassistische Ressentiments gibt es immer auch wieder unter Polzeibeamten: Wir kennen leider viele Vorfälle, wo Wissenschaftler nicht professionell von der Polizei betreut wurden – der Verdacht liegt nahe, dass es daran lag, dass sie Ausländer sind. Aber gerade Minderheiten müssen sich bei der Polizei gut aufgehoben und sicher fühlen.
Was das Thema so schwierig macht: Im Gegensatz zur Einigkeit bei Wirtschaftsfragen ist die Frage des Umgangs mit Ausländern ein strittiges Thema in Deutschland. Einerseits heißen die Deutschen Ausländer herzlich willkommen, da sie sie als eine Antriebsfeder der Wirtschaftsentwicklung sehen. Andererseits sind sie sich noch nicht sicher, inwieweit sie sie als Teil der Gesellschaft akzeptieren wollen. Als Mitglied des Ausländerbeirats habe ich jeden Monat gesehen, wo es durchaus unterschiedliche Meinungen deutscher Politiker darüber gibt, wie Ausländer am besten in Dresden integriert werden könnten und in welchem Maße sie eingebunden werden sollten in Entscheidungen des Stadtrats. Dieser Zielstrebigkeit fehlt, und musst diskutiert werden in offene Debatte Über all Parteigrenzen und schichten der Gesellschaft.
Ein Wichtige Schritt der bereits angenommen wurde ist Doppelstaatsbuergerschaft. Viele fragen mich immer noch warum es so Wichtig war. Ich nehme dafür gern meine eigenen Kinder als Beispiel, die in Deutschland zur Welt gekommen, in den Kindergarten und zur Grundschule gegangen sind. Jetzt sind Sie in der International School in Dresden. Es sind Kinder mit guter Schulbildung, die – würde ich denken – die deutsche Gesellschaft gern auf Dauer bei sich aufnehmen würde. Schließlich hat Deutschland ihre Ausbildung auch zum größten Teil bezahlt. Sie sind nicht nur in zwei Sprachen aufgewachsen, sondern in zwei Kulturen. Wenn sie von einer Sprache in die andere wechseln, dann wechseln sie auch den kulturellen Bezug. Aber sie sehen sich nicht als Deutsche und orientieren sich bei der Entscheidung für ein Studium in Richtung Ausland. Warum? Nun, der Grund ist: Sie haben keinen deutschen Pass.
Eltern möchten, dass ihre Kinder ihnen so ähnlich werden wie möglich – das ist sogar eine der Grundlagen der Erziehung. Was soll ein Kind da machen, wenn man ihm sagt, dass es mit 18 Jahren kein Recht mehr haben wird, in Deutschland zu leben? In Ländern wie Amerika erwirbt man mit der Geburt das Recht auf einen Pass. Das stärkt schon im Kindesalter das Gefühl dazuzugehören, Teil dieser Gesellschaft zu sein. In Deutschland erreichen die Kinder irgendwann das Alter, in dem sie einen deutschen Pass beantragen können, aber dann haben sie einfach keine Bereitschaft mehr, die Staatsbürgerschaft aufzugeben, mit der sie seit ihrer Geburt leben, in der sie ihre Identität gefunden haben. Mit der Doppelstaatsbuergerschaft müssen mein Kindern nicht mehr entscheiden.
Andere Staaten machen es bei der Einwanderung nicht unbedingt besser. Selbst die USA, einst ein leuchtendes Beispiel intelligenter Einwanderungspolitik, sind seit dem 11. September zurückgefallen. Angesichts seiner zentralen Lage in Europa muss Deutschland eine moderne Einwanderungspolitik schaffen und gemeinsam mit seinen europäischen Partnern Regeln einführen, die die Bürger auch mittragen. Man kann nur hoffen, dass Deutschland auch in den nächsten zwanzig Jahren beispielgebend für den Rest der Welt dastehen kann als ein Land der eine gute und faire Art findet, mit den Menschen umzugehen, die in dieses Land kommen sollen.
Vor zwanzig Jahren lebte ich in San Francisco und spielte mit dem Gedanken, nach Heidelberg zu ziehen. Meine Kollegen hielten mich für verrückt. Ähnlich mein Vater – als ich ihm am Telefon den Plan unterbreitete, musste er sich erstmal setzen und gab den Hörer an meine Mutter weiter. Dass mein Vater anfänglich so entsetzt war über meinem Umzug nach Deutschland, lag an dem nach wie vor starken Einfluss seiner jüdischen Herkunft und dem Leid, das seiner Familie während des Krieges widerfahren ist. Im Laufe der Jahre hat er Dresden immer mehr ins Herz geschlossen – weil es eine so schöne Stadt ist, aber auch wegen der Herzlichkeit und offenen Art der Menschen in den Freundeskreisen, die mich und meine Frau während der 15 Jahre, die wir nun in Dresden leben, so freundlich aufgenommen haben. Er erkannte, dass Deutschland sich seiner dunklen Vergangenheit gestellt und daraus für die Zukunft gelernt hat. Kurz bevor er starb, erinnerte er mich:
“Nur wer weiß, kann vergeben”